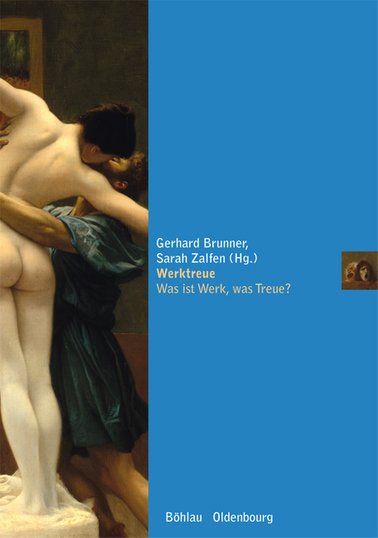Dieter David Scholz
Musik-Theater & mehr
Nichts ist mehr sakrosankt. "Erlaubt ist, was gefällt"
Wie weit darf ein Regisseur gehen?
Kein Begriff ist derzeit unter Opernbesuchern wie -Regisseuren, Kritikern wie Publikum so in der Diskussion wie der des "Regietheaters". Dabei geht es letztlich um die Frage nach der "Werktreue". Wie weit darf ein Regisseur mit seiner Neudeutung einer Oper gehen? Was ist eigentlich ein Werk, und was bedeutet Treue gegenüber dem Werk? Diesen Fragen ist ein Symposium an der Universität Zürich vor zwei Jahren nachgegangen. Zur genaueren Klärung der vielbenutzten, aber uneindeutigen Begriffe hat Gerhard Brunner, Leiter des Züricher Universiätslehrgangs "Executive Master in Arts Administration" fünf Wissenschaftler, 4 Regisseure und 5 Kritiker bzw. Medienvertreten eingeladen. Ihre Beiträge sind bei Böhlau/Oldenbourg veröffentlicht worden. Gerhard Brunner und Sarah Zalfen haben sie als Buch he-rausgegeben. 224 Seiten.
Verdis "Rigoletto" auf dem Planeten der Affen, Mozarts "Entführung aus dem Serail" im Bordell oder Wagners "Lohengrin" im Klassen-zimmer: Wer hätte nicht derlei Beispiele sogenannten "Regietheaters" immer wieder erlebt, Inszenierungen, die den Eindruck nahelegen, dass für viele Opernregisseure die Begriffe "Werk" und "Werktreue" keine Rolle mehr spielen. Die Oper scheint heute vor allem eine Spielwiese egomanischer Regisseure geworden zu sein ,,die sich selbst wichtiger nehmen als das "Werk". Verständlich, dass viele von ihnen den Begriff "Regietheater" rundweg ablehnen. Der Musikwissenschaftler Anselm Gerhard nennt "Werktreue" denn auch einen "Phantombegriff", auf den man besser verzichten solle, da ihm jede "Trennschärfe" fehle, "jede Möglichkeit, den vertrackten Widersprü-chen und Aporien einer vom Historismus geprägten Kultur gerecht zu werden, die darauf beharrt, vor allem vergangene Werke in die Gegenwart einer heutigen Bühnenaufführung zu transformieren".
Der Theaterwissenschaftler Sieghard Döhring macht die "Aufwertung des Szenischen in der Geschichte der Oper" verantwortlich dafür, dass Regie und Bühnenbild oftmals über Musik und Intention eines Werks gestellt werden. Und er fragt zurecht: Steht Regie tatsächlich immer im Dienst der "Wahrheit eines Werks"? So gegensätzlich sie waren: Bei Wieland Wagner oder Lucchino Visconti durfte man diese Frage wohl noch eindeutig bejahen. Aber heute? Salomonisch unterscheidet Döhring zwischen statischem und dynamischem Werkbegriff. "Ein dynamischer Werkbegriff verhelfe der Aufführung "neben dem Text zu ihrem ganz eigenen Recht". Döhring beklagt dennoch die zunehmende Abkehr vom Werkbegriff. Der Musik- und Theaterwissenschaftler Rainer Simon spricht in seinem Essay sogar von der vorherrschenden "Treulosigkeit" dem Werk gegenüber.
Für Regisseur Peter Konwitschny bedeutet die Frage nach Werk und "Werktreue" die Alternative zwischen "totem oder lebendigem Thea-ter". Stücke seien schließlich dazu da, "dass wir etwas an unserer Existenz verändern", so Konwitschny. Er hat es uns ja in seinen Insze-nierungen, ich erinnere nur an seinen "Don Giovanni", exemplarisch vorgeführt, dass es ihm mehr um seine Existenz, seine Erotik, seine Weltsicht geht, statt um die des Komponisten bzw. Librettisten. Zu schweigen von der des Zuschauers. Ein für viele heutige Regisseure bezeichnender, arroganter Standpunkt. Der Dirigent und Musikologe Peter Gülke protestiert denn auch dagegen und erinnert daran, dass es doch so etwas wie die "Würde" des Werks gebe, den "Ankergrund unserer kulturellen Identität". Doch er ist ein einsamer Rufer in der Wüste
Auch Regisseur Christof Loy, der am Beispiel seiner Inszenierung von Mozarts "Entführung aus dem Serail" Einblicke gibt in "Gefühls- und Gedankenprozesse" der szenischen Realisierung eines Werks", distanziert sich vom Begriff der Werktreue. "Was zähle, sei einzig die Aufführung in der Gegenwart". Die Regisseurin Tatjana Gürbaca macht deutlich - und sie belegt es mit Interviews, die sie mit Regiestu-denten führte - dass für die jüngste Generation von Regisseuren "Werktreue" nicht nur ein zu vernachlässigender, sondern geradezu ein negativ besetzter Begriff sei, der keinerlei Berechtigung mehr habe. "Erlaubt ist, was gefällt" so liest man, "Umschreiben der Handlung, Kürzen, Hinzufügen, Umstellen, Parallelmontagen mit Film oder anderen Genres, andere Besetzungen und auch andere Instrumen-tierungen sind denkbar". Der kleinste gemeinsame Nenner sei, "das Stück ernst zu nehmen". Immerhin.
Die Debatte um die Werktreue - so wird nach der Lektüre der 13 Beiträge und der 3 Diskussionsnotate deutlich, ist nicht nur eine "Scheindebatte", wie der Journalist Claus Spahn meint, sondern ein offenbar hoffnungsloser Diskurs einander konträr und unvereinbar gegenüberstehender Meinungen und Positionen. Die Kritikerin Christine Lemke-Matwey spricht es aus: Die Regisseure von heute, noch mehr die der Zukunft, wollen sich keinem "Kunst und Ausdruckswillen" mehr unterstellen lassen. Die Oper hat für sie keinen verbindli-chen Kunstcharakter mehr. Deshalb gibt es für sie auch keinen verbindlichen Werkbegriff mehr. Schlimmer noch: Lemke-Matwey bilanziert, dass dem Theater "keine Relevanz, keine Wirkung mehr" zukomme. Deshalb werde diese "auch in den Werken nicht mehr aufgesucht". Nichts ist mehr sakrosankt, weder Text, noch Komposition. Ein deprimierendes Fazit.
Im abschließenden Kapitel des Buches - über geschütztes Werk und Theaterrecht - rechtfertigt der Jurist Peter Mosiman die Abkehr vom Werkbegriff mit dem juristischen Begriff von der "Kunstfreiheit". Regisseure wie Dirigenten dürften für sich in Anspruch nehmen, "dem Autor auf Augenhöhe zu begegnen". Diese Anmaßung der Gleichsetzung von totem Autor und lebendigem Interpret, oftmals von Genie und Nicht-Genie, sei juristisch abgesichert, wenn "Werk und Inszenierung einen gemeinsamen Sinn ergeben". Nur dass man sich über den füglich streiten kann. Und tote Autoren bzw. Komponisten können sich gegen Vergewaltigung, Missbrauch und Schändung ihrer Werke nicht mehr wehren.
Der Musikwissenschaftler Anselm Gerhard versucht zwar einen Kompromiss, indem er der ganzen Debatte über Werk und Werktreue ausweicht. Es komme schließlich bei einer Opernaufführung auf "die ästhetische Überzeugungskraft ... im Verhältnis zu den jeweiligen Vorlagen" an. Dem kann nicht widersprochen werden. Bliebe nur zu fragen: Wie stehts denn mit der immer austauschbarer und eintöniger werdenden Bühnenästhetik vieler heutiger Regisseure? Mit ihrem Geschmack, mit ihrem Stilgefühl und ihrer Stück-Kenntnis? Doch diese Fragen werden leider in dem Buch von Gerhard Brunner nicht beantwortet. Peter Konwitschny mokiert sich stattdessen in der Schlussdebatte über die Ungebildetheit des heutigen Publikums. Aber die Frage nach der Bildung der Regisseure wird nicht gestellt. Obwohl sie sich bei vielen heutigen Opernregisseuren, oftmals bekennenden Quereinsteigern und Opernverächtern, geradezu aufdrängt.
Zeugt es tatsächlich von großer Bildung und Phantasie, wenn zwischen New York und Mailand, Wien und Berlin die meisten Stücke in Sechzigerjahrekostümen und Kleinbürgerwohnungseinrichtungen gezeigt werden? Ist es tatsächlich so, wie Christine Lemke-Matwey behauptet, dass viel gewonnen sei, wenn Oper in "Bilder ... unserer heutigen Lebenswirklichkeit " übersetzt wird? Eben diese stereotypen Aktualisierungen haben doch dazu geführt, dass Oper immer austauschbarer, langweiliger und phantasieloser wird. Nicht jedes Werk lässt sich in unsere Gegenwart transformieren. Es muss auch gar nicht aktualisiert werden. Ein begabter Regisseur kann auch im Historischen aktuelle Brisanz vermitteln. Nur scheint es heute offenbar zu wenige begabte Regisseure zu geben. Darüber schweigt sich das Buch von Gerhard Brunner geflissentlich aus. Wir werden also weiterhin mit Kleinbürgerwohnungen, Blümchentapeten, "Nacktheit, Blut, Sperma und Nazistiefeln" auf der Opernbühne leben müssen. Das Schlußwort des ehemaligen Opernintendanten Klaus Zehelein, dass die Sache mit der "Werktreue" sehr kompliziert, aber wenigstens ein Zeichen von Leben sei, tröstet einen darüber nicht hinweg.
Beiträge in SWR 2, MDR Figaro