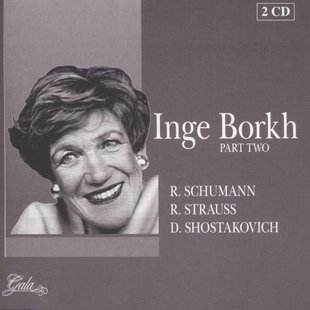Dieter David Scholz
Musik-Theater & mehr
Also ich muss ja kein Blatt vor den Mund nehmen
Zum Tode der großen Sängerdarstellerin heute, am 26.08.2018 hier noch einmal zur Erinnerung mein Interview, das ich in den Neunzigerjahren mit Inge Borkh geführt habe. Es wurde in meinem Buch „Mythos Priomadonna“ (Parthas Verlag, Berlin 1999) abgedruckt.
Frau Borkh, Sie haben sich einmal als Zigeunerin bezeichnet. Gehört das Herumreisen, das Nichtseßhaftsein wesentlich zu Ihrem Leben?
Das ist mein Leben! Ich bin eine Zigeunerin im besten Sinne. Man macht mir immer wieder den Vorwurf, dass ich zu viel auf einmal tue und nicht mehr zu meinem ruhigen Leben komme. Das stimmt nicht. Ich bin an sich ein Mensch, der in sich ruht. Aber ich bin überall da zu Hause, wo es Theater gibt, wo es Konzerte gibt, wo es liebe Menschen gibt, mit denen ich mich gut ver-stehe, manchmal auch streite. Das meint mein Zigeunersein. Nicht von Ort zu Ort reisen, um etwas zu erleben. Ich bin gezielt auf der Wanderschaft!
Hat das mit Ihrer frühen Erfahrung, ins Exil gehen zu müssen, zu tun? Sie sind ja als Jugendliche mit ihren Eltern vor den Nazis in die Schweiz geflohen.
Das kann damit zu tun haben, ja. Natürlich ist man nach solchen Erfahrungen entwurzelt. Man hat nicht mehr das „normale“ Heimatgefühl. Ich bin in Mannheim geboren, habe dort meine Kindheit verbracht, es ist meine Heimat. Aber ich bin von dort vertrieben worden und musste mir unterwegs neue Freunde suchen. Mannheim hat heute überhaupt keine Bedeutung mehr für mich.
Sie haben dann in der Schweiz gelebt, mit kurzem Vorspiel in Wien, wo Sie ja ihre ersten Schritte auf dem Theater machten. Später haben Sie in Deutschland Quartier bezogen. Wo fühlen Sie sich heute zu Hause?
Ich habe kein örtliches Zuhause mehr. Das Theater ist meine Welt, so pathetisch sich das anhört. Aber das kann man, glaube ich, nicht mehr loswerden, auch nach Abschluss des aktiven The-aterlebens nicht. Deswegen habe ich ja meine Memoiren auch überschrieben: Ich komme vom Theater nicht los! Ich bin und bleibe ein Theatermensch, ein Künstler. Und wo es Kunst gibt, da fühle ich mich wohl, dort gibt es auch ein Zuhause für mich. Natürlich habe ich eine Wohnung in Stuttgart und eine kleine Wohnung in der Schweiz. Da ist man in einer gewissen Häuslich-keit. Aber meine Heimat ist die Welt.
Ihr Leben ist ein Theaterleben. Das ist Ihnen natürlich mütterlicherseits schon in die Wiege gelegt worden.
Das ist richtig. Es wurde in unserem Elternhaus immer viel von Theater und Musik und Kunst gesprochen. Und meine Mutter war eine Sängerin, schon meine Großmutter und mein Groß-vater waren Sänger. Ich wurde bewusst auf das Theater hin erzogen, gewiss. Aber ich bezweifle, dass man einen Menschen so prägen kann, wenn er nicht schon von vornherein etwas Beson-deres mitbringt an Voraussetzungen. Ich sollte eine Künstlerin werden. Und ich bin eine gewor-den. Aber nur, weil ich etwas Künstlerisches in mir hatte. Man kann kein Kind, auch nicht ein Kind aus Künstlerehe, zu einem Künstler machen, wenn es nicht etwas in sich trägt, das dazu befähigt!
Haben Sie darunter gelitten, auf eine Künstlerkarriere hin erzogen worden zu sein?
Nein! Ich war glückselig, dass ich zum Theater durfte. Ich wollte es ja unbedingt. Und man hat mich zu nichts zwingen müssen, weder zum Klavierspielen, noch zu Gesangsübungen. Man musste mich eher zwingen zur Schule zu gehen, zu rechnen und brav auf der Bank zu sitzen und das zu tun, was der Lehrer sagte.
Zum Sängerberuf haben Sie ja erst auf Umwegen übers Sprechtheater gefunden, nicht wahr?
Ja, ich wollte eigentlich zunächst viel lieber Schauspielerin werden. Und wenn ich wieder auf die Welt komme, dann werde ich es auch. Aber ich bereue nicht einen einzigen Tag meines Sängerlebens und bin auch dankbar für diese Karriere, die ich erleben durfte. Das ist ja nichts Selbstverständliches! Und ich habe mich auf der Opernbühne ausgelebt. Es war ja so, dass ich das Glück hatte, in eine Zeit hineinzuwachsen, in der das Schauspielerische in die Oper Einzug hielt und Wert darauf gelegt wurde, dass ein Sänger sich auch schauspielerisch ausdrücken kann. Ich habe immer weitgehend vom Schauspielerischen her auf der Bühne agiert, freilich dem Singen untergeordnet.
Sie haben ein internationales Opern-Reiseleben gelebt. Wie verträgt sich so ein Zigeunerleben mit dem Privatleben?
Nun, Sie wissen, dass ich in erster Ehe einen lieben Menschen geheiratet habe, der mich liebe-voll und gütig begleiten wollte am Anfang meiner Karriere. Er war aber ein Rechtsanwalt, der an seinen Ort der Berufsausübung gebunden war, ein Schweizer Bürger durch und durch. Es war eigentlich vorprogrammiert, dass das nicht gutgehen konnte angesichts meiner sich anbah-nenden internationalen Karriere. Dann begegnete ich einem Sänger, Alexander Welitsch, der zwar ein bisschen älter war als ich, aber immer noch auf einem gewissen Höhepunkt seiner Sängerlaufbahn. Wir konnten doch immerhin einige Jahre miteinander reisen, als Liebende, als Partner im Leben und auf der Bühne. Wir haben natürlich versucht, soviel wie möglich mit-einander zu singen. Das ging etwa zehn Jahre lang. Dann hat mein Mann aufgehört mit dem Singen. Er hat mich aber als ständiger Berater und kritisch Verstehender, als Weggefährte durch die Welt begleitet. Auch das war ein großer Glücksfall.
Viele Sänger verlieren ja, wenn sie Erfolg haben, das Augenmaß für eigene Schwächen, vor allem für stimmliche Probleme. Nun hat jeder Sänger Krisen. War Ihnen Ihr Mann da eine Hilfe?
Man hört natürlich auch nicht auf den eigenen Mann, wenn er kritisiert. und er kritisierte mich hart! Ich wurde deshalb oft sehr böse. Nun war er auch ein sehr heftig aufbrausender Mensch. Er hat mich oft während einer Aufführung angefahren, wie schlecht ich heute in Form sei. Das war schmerzhaft manchmal. Aber letzen Endes war ich ihm doch dankbar, weil ich mich dann manchmal noch innerhalb der Aufführung fangen, steigern und verbessern konnte, so dass das Publikum im zweiten und dritten Akt noch auf seine Kosten kam.
Sie haben mit sehr vielen berühmten Dirigenten wie Mitropoulos, Reiner, Solti und Böhm zusammengearbeitet. Nur mit Carlos Kleiber kam keine Zusammenarbeit zustande.
Mit ihm habe ich eine schreckliche Erfahrung gemacht. Ich wurde damals vom Intendanten in Stuttgart, Herrn Schäfer, eingeladen, zu meinem Geburtstag eine „Elektra“-Serie zu singen. Ich bin auf die erste Probe zu Herrn Kleiber gekommen. Wir haben solide probiert, es schien mir unkompliziert und einvernehmlich. Als ich gehen wollte, sagte er mir: „Sie wissen, dass ich die Elektra strichlos mache.“ „Um Gottes Willen“, sagte ich zu Kleiber, „nein, das kann man nicht strichlos machen, das hat noch nie strichlos stattgefunden. Ich kann das einfach nicht.“ Sie kön-nen sich nicht vorstellen, was daraufhin für einen Kampf zwischen dem Generalintendanten, der mir die sieben Vorstellungen versprochen hatte, und dem Dirigenten Carlos Kleiber losbrach. Herr Schäfer setzte sich für mich ein, aber Herr Kleiber wollte mich von da an nicht mehr. Vielleicht hatte er mich von Anfang an nicht wollen. Er suchte jedenfalls andere Elektra-Sänge-rinnen und hatte große Mühe, eine zu finden. Am Ende wurde die Aufführung doch nicht strichlos gegeben, nur ohne mich. Aber sie wurde gleich wieder vom Spielplan abgesetzt. Das war mein Erlebnis mit Herrn Kleiber.
Wie war denn Ihre Zusammenarbeit mit Karl Böhm, der ja als Richard-Strauss-Experte galt?
Wir haben uns zunächst phantastisch verstanden. Wir haben herausragende, sehr erfolgreiche „Elektra“-Vorstellungen in aller Welt zusammen gemacht. Wir haben in New York gemeinsam im Hotel Alden gewohnt, in dem ja alle Künstler wohnen. Ich war oft zu den Böhms aufs Zimmer eingeladen, oder habe ein Abendessen zu den Böhms hinuntergetragen, habe ab und zu auch einen guten Whisky mitgebracht, den die Thea Böhm so schätzte. Es schien alles freund-schaftlich. Wir machten schließlich die „Elektra“-Aufnahme in Dresden, dann sollte „Salome“ folgen. Und alles war geplant und verabredet, auch mit der Plattenfirma. Aber plötzlich und unvermittelt hieß es: diese „Salome“ findet nicht statt. Ich spürte von dem Moment an, dass irgendetwas verändert war in unserem Verhältnis. Ich weiß nicht, was hinter meinem Rücken passiert war. Jedenfalls war von diesem Zeitpunkt an meine Zusammenarbeit mit Böhm schlagartig beendet. Ich weiß bis heute nicht, warum. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt mehr seither.
Wie kommt man mit solchen Enttäuschungen zurecht?
Ich habe ja mit Knappertsbusch ähnliches erlebt am Anfang meiner Karriere. Ich wusste damals nicht, dass er so furchtbare Flüche und Kraftausdrücke herausschleudern konnte. Ich kam ja als behütetes Mädchen aus einer sehr kultivierten Familie und war derbe Naturen nicht gewohnt. Wir waren also in Rom, hatten öffentliche Generalprobe, ich sang Elektra, Res Fischer sang Klytämnestra, plötzlich unterbrach Knappertsbusch und schrie einen furchtbaren ordinären Fluch zu uns auf die Bühne herauf. Als ich ihn hörte, rannte ich sofort von der Bühne und ließ verlautbaren, dass ich keinen Ton mehr unter Knappertsbusch singen würde. Ich wusste aber damals nicht, dass er der ungekrönte König von München war. Ich hatte mir vieles verbaut dadurch, dass ich mir sein Verhalten so zu Herzen genommen hatte. Knapperstbusch war sehr wütend und hat mir meine Reaktion auf sein unfeines Verhalten nie verziehen. Wenn ich eine Wagnersängerin geworden wäre, wäre meine Karriere damals sehr in Gefahr gewesen. Denn Knapperstbusch war ja der große Wagner-Papst. Er hat übrigens dafür gesorgt, dass ich in München einige Jahre gesperrt wurde und dort nicht mehr singen durfte.
Nun gibt es nur wenige so unbeherrschte, rüpelhafte Dirigenten.
Ja, gottlob. Aber es gibt dafür viele Dirigenten, die einem mit weit subtileren Formen von Un-verschämtheiten zusetzen. Zum Beispiel habe ich am Anfang meiner Karriere mit Fricsay in Berlin einmal „Fidelio“ gesungen. Der rief doch ganz selbstherrlich auf die Bühne herauf: Singen Sie nur die richtigen Töne, gnädige Frau, das Gefühl machen wir dann hier unten!
Nun waren Sie ja immer eine sehr impulsive und temperamentvolle Sängerin.
Allerdings! Aber mein Mann war noch temperamentvoller. Er konnte wüten und schreien, dass die Wände wackelten. Man hat es ihm aber eher abgenommen als mir, er war der Kerl dazu. Das war schon sehr eindrucksvoll. Mir hat man meine gelegentlichen Ausbrüche nie geglaubt. Ich bin zwar groß und wurde als starkes Weib gehandelt. Aber ich bin eigentlich immer eine zart besaitete Frau gewesen. Auch wenn ich nicht danach aussah. Glauben Sie mir, es ist viel leich-ter, ein Püppchen zu sein! Nur leider war ich das nie.
Nun haben Sie allerdings auch mit Vorliebe Kraftweiber dargestellt. Was hat Sie denn an diesen meistenteils hochneurotischen Frauengestalten so gereizt?
Ja nun, mich haben diese Weiber gar nicht so sehr gereizt. Man hat mich in dieses Fach hinein-gedrängt. Es hieß halt: die Borkh, die sieht so aus, die kann das. Diese Rollen wurden mir zugeworfen. Ich war an sich eine lyrische Sängerin, mit Durchschlagskraft, mit einer gutsitz-enden, weittragenden Höhe, aber ohne Hochdramatik wie etwa die Nilsson sie besaß. Aber sie ist ja ohnehin eine Ausnahmeerscheinung. Manche dramatische Sängerinnen haben wesentlich mehr Stimme gehabt als ich, größere Stimme. Meine Stimme war nur tragend. Aber ich wurde tatsächlich in die dramatischen Rollen hineingedrängt. Nicht, dass ich mich in diesen Partien unwohl gefühlt hatte, nein! Ganz und gar nicht. Aber ich wäre so gern eine Donna Elvira ge-wesen, ich hätte gerne mehr Verdi gesungen. Dadurch wäre ich auch einem größeren Opern-publikum bekannt geworden. Es ist ja nicht jedermanns Sache, Elektra und Salome zu hören. Ein Großteil des Publikums hört lieber Verdi und Mozart als Richard Strauss. Dass seine Musik mein Leben war, streite ich nicht ab.
Sie haben alles getan, um zunächst ein ganz anderes Fach zu singen, indem Sie sich in Mailand von Antonio Moratti zur Koloratursängerin ausbilden ließen.
So ist es, auch wenn man das kaum glaubt! Meine Stimme kommt von oben, von der Höhe her. Deshalb fehlte mir die profunde Mittellage, die für Wagner unbedingt notwendig ist. So habe ich auch nur die Senta und die Sieglinde je gesungen, auch die Freia, aber das ist eine kleine Partie. Das war möglich. Aber die wirklich hochdramatischen Partien der Brünnhilde oder Isolde, die müssen ja doch eher vom Mezzo-Fach her angegangen werden. Ausnahmen wie die Nilsson bestätigen die Regel.
Sie haben mit Wieland Wagner gearbeitet. Wie waren Ihre Erlebnisse mit diesem anscheinend so verschlossenen Menschen und Regisseur? Viele Ihrer Kolleginnen bezeichneten ihn als unnahbar, ungreifbar.
Ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Ich habe mich mit ihm ausgezeichnet verstanden. Wir haben sehr produktiv miteinander gearbeitet. Leider viel zu wenig, was ich auch im Falle Ka-rajans bedaure. Das sind zwei Männer, mit denen ich mich künstlerisch ausgezeichnet hätte verstehen können, wenn wir uns öfter getroffen hätten. Was das Schicksal nicht wollte.
Mit Wieland Wagner war es deshalb ein bisschen schwierig, weil ich, als ich in Bayreuth engagiert war, glühend verliebt war in meinen Mann und Tag und Nacht nur an Alexander Welitsch dachte und viel zu wenig an die Sieglinde, die ich zu singen hatte, und an Wieland Wagners Regie. Jede Minute, die ich frei hatte, raste ich mit meinem Auto nach Stuttgart zu meinem Geliebten. Das war natürlich keine gute Voraussetzung für einen so arbeitswütigen Menschen wie Wieland. So blieb ich dann manchmal von den Proben weg, oder ich kam zu spät, was ihn wahnsinnig geärgert hat. Er hat ja immer sehr früh in Kostüm und Maske probiert. Das war mir oft gar nicht möglich, weil ich eben erst in letzter Minute aus Stuttgart zurückkam. Das war eine Zeit, die leider nicht favorabel war für unsere Zusammenarbeit. Aber dennoch war er absolut der Überzeugung, dass er eine Isolde aus mir machen wollte. Und ich war schon auf dem Weg dahin und wollte es probieren. Wir haben ja in Turin Siegfried miteinander gemacht. Was dann auch aus anderen Gründen so ein bisschen schiefging, weil ich eben gar keinen Halt hatte von dem Dirigenten. Der war ein lieber, herzensguter Mensch, ein älterer Herr, der ge-wohnt war, mit großen, gestandenen Sängerinnen zu arbeiten. Er hat gar nicht damit gerechnet, dass ich eine blutige Anfängerin war und dass man mich behutsam führen musste. Also wurde ich am Tag nach der Premiere schon heiser, und ich wusste: um Gottes Willen, nein, so darf ich nicht weitermachen. Als Mensch kann ich über Wieland eigentlich nichts sagen. Ich habe übri-gens meinen vierzigsten Geburtstag mit Wieland in Turin gefeiert, und da eröffnete er uns, dass die Anja Silja gerade einundzwanzig Jahre alt geworden sei.
Sie haben den Namen Karajan in die Waagschale geworfen. Wie waren Ihre Erlebnisse mit dem Machtmenschen unter den Pultvirtuosen?
Also ich muss ja kein Blatt vor den Mund nehmen, Gott sei Dank. Das ist der Vorteil, wenn man mit seiner Karriere aufgehört hat, dass man Dinge beim wahren Namen nennen kann, ohne vor irgendwem Scheu zu haben. Karajan hat mich zu meiner Hochzeit als Salome an die Mailänder Scala eingeladen. Mein lieber Alexander, der ja mit mir unendlich oft den Jochanaan gesungen hat, wollte ihn natürlich auch an der Scala mit mir singen. Also schrieb ich Karajan, hocher-freut, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, einen selbstbewussten Brief mit der Forderung, mein Mann solle dann aber den Jochanaan singen. Der Maestro empfand dies als unverzeihliche Anmaßung. Er schrieb mir zurück, ich hätte nicht zu bestimmen, wer den Jochanaan zu singen habe. Er habe nunmehr beschlossen, dass weder mein Mann noch ich engagiert würden. Karajan und ich sind uns danach noch oft begegnet, wir sind uns nicht unsympathisch gewesen und wussten beide, dass wir gut miteinander würden arbeiten können. Aber diese Mailänder Salome-Erfahrung hat alles weitere überschattet. Natürlich bereue ich diese dumme Geschichte heute, und ich kann Karajan verstehen. Ich hätte vielleicht etwas diplomatischer sein sollen. Ich habe später immer wieder Kontakt mit ihm gesucht. In Wien habe ich mit ihm schließlich auch gesungen, aber aus der Aufregung heraus war ich völlig indisponiert. Und so war es fortan immer wieder mit Karajan. Es sollte wohl nicht sein, dass wir zusammenkommen. Es gibt solche Konstellationen im Leben.
Sie haben in Ihrem Buch zu verstehen gegeben, dass Sie mit politisch wachem Sinn durch die Welt gehen, ohne deswegen explizit politisch zu sein. Hat Sie die Karajansche Nazivergangenheit nie gestört?
Ist nicht jeder Künstler, der seine Kunst ausüben will, ob singend oder dirigierend, opportu-nistisch? Als ich ihm begegnet bin, wusste ich übrigens noch gar nichts von seiner Naziver-gangenheit. Im Grunde bin ich ja auch ein unpolitischer Mensch. Hätte ich gewusst, dass er seine erste Frau verstieß, weil sie eine Jüdin war, wie ich später erfuhr ... aber das wusste ich damals noch nicht. Ich wusste auch nichts von der Vergangenheit der Elisabeth Schwarzkopf damals. Ich habe sie übrigens neulich im Flugzeug getroffen und sie war ganz aufgeregt und fragte mich: „Was sagen Sie zu dieser Unverschämtheit, dass dieser Jefferson so ein Buch über mich geschrieben hat?“ Ich habe ihr nur gesagt: „Meine liebe Frau Schwarzkopf, ich kenne das Buch nicht und habe es nicht gelesen.“ Ich finde, jeder muss mit seiner Vergangenheit fertig werden.
Wenn ich Karajans Vergangenheit gekannt hätte, so wie ich zum Beispiel den Antisemitismus von Richard Strauss kenne, weshalb sich mir oft der Hals zuschnürt bei der schönen Musik, die er komponierte, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte... Es wäre mir schwergefallen, mich mit ihm anzufreunden, ohne Zweifel. Aber über einen Menschen, von dem ich das nicht weiß, Muss ich mir keine Rechenschaft ablegen.
Sie haben ein sehr geradliniges Leben gelebt und sehr aufrichtige Memoiren geschrieben. Was nicht selbstverständlich ist bei Sängern, die ja gerne ihre Biographie retuschieren und über-höhen. Sie haben in Ihrem Buch auch Ihr Judentum thematisiert. Sie sind zwar jüdischer Ab-stammung, aber nie jüdisch religiös oder auch nur traditionell erzogen worden.
Wissen Sie, ich habe zur Religion als einer allgemeinen Bindung an eine höhere Macht, eine starke Beziehung. Ich habe mich dazu ja auch schriftlich und mündlich in Form von Vorträgen immer wieder geäußert. Ich gehöre aber nicht zu den Menschen, die sich in einer bestimmten Konfession beheimatet wissen. Das sind doch alles menschliche, allzu menschliche Konstruk-tionen. Alles was wir denken und glauben ist menschlich, und damit begrenzt. Den Schleier der Maja können wir nicht wegziehen, um mit Schopenhauer zu reden. Also die Konfessionen haben für mich keinerlei Bedeutung. Es gibt wunderbare Priester, ohne Zweifel, aber auch sie sind nur Menschen. Ich binde meinen Glauben an keinerlei menschliche Institutionen. Deswegen ist es mir einerlei, ob jemand ein Jude, ein Katholik, ein Hindu oder ein Moslem ist. Wichtig ist mir, dass er Mensch ist. Und wenn ich mich mit einem Menschen sehr gut verstehe, freue ich mich darüber, dass wir uns vielleicht in eine beglückende geschöpfliche Abhängigkeit begeben. Wir sind alle Geschöpfe Gottes.
Hat ihnen diese Gläubigkeit in Ihrem Beruf gedient?
Ja und ob! Sie hat mir unendliche Kraft gegeben. Ich empfinde in mir eine Gnade, Sängerin, Künstlerin zu sein. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mit 78 Jahren allmorgendlich aufwache und die Sonne, die Blumen, den Himmel anschauen kann und lieben Menschen begegnen kann. Auch so etwas wie Sympathie ist doch ein Geschenk.
Glauben und Glaubenskraft allein reichen für diesen Beruf natürlich nicht aus. Sie haben auch hart gearbeitet. Auch und vor allem an der Stimme. Wie wichtig war für Sie Gesangstechnik?
Also ich hatte eine Naturstimme und ich habe schon als Kind meine Mutter imitiert, sie hatte eine wunderbare, hervorragend ausgebildete Stimme auf hohem stimmtechnischem Niveau. Sie hat bis zu ihrem achtzigsten Lebensjahr jeden Tag gesungen. Sie lebte zuletzt in Genf, mein Vater war ja ein reicher Mann. Er konnte sich viel leisten. Dazu gehörte auch, dass sie zweimal in der Woche einen Korrepetitor engagierte, der mit ihr musizierte und immer noch Neues ein-studierte. Sie haben auch zweihändig Klavier gespielt. Sie sang auch jeden Sonntag in der Kirche. Das war natürlich ein Glück für mich, solch eine Mutter zu haben, die mir das Singen schon im Kindesalter beibringen konnte, ohne jedes eigentliche Bewusstsein von Technik. Meine Mutter war mir eine große Hilfe, auch später, bei den vielen Gesangslehrerinnen, die ich hatte, denn sie konnte mich immer korrigieren und mir sagen, was richtig und was falsch war. Sie war mein bester Ratgeber und Lehrer.
Haben Sie das je weitergegeben als Lehrerin?
Ja, ich habe an der Singschul in München versucht, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Das sind natürlich keine gesangstechnischen Übungen. Aber ich sage den jungen Sängern alles, was ich weiß, wie ich gesungen habe und wie ich gespielt habe auf der Bühne. Das Wichtigste, wozu ich die jungen Sänger auffordere, ist allerdings die Bitte, dass sie ihre Persönlichkeit so heranbilden, dass sie gewisse Unsinnigkeiten nicht begehen, zu denen sie heutzutage aufgefordert werden. Ich mache diese Meisterkurse in München mit großer Freude! Ich opfere den ganzen Juli dafür, obgleich ich eine leidenschaftliche Wanderin und Schwim-merin bin. Aber ich opfere mich mit großer Freude den jungen Menschen.
Gibt es denn hoffnungsvolle Stimmen?
Es gibt unendlich viele gute Stimmen. Die Agenten machen natürlich den Fehler, dass sich alles nur noch ums Geld dreht, um die Vermarktbarkeit von Stimmen, und viele junge Sänger sind Opfer ihrer eigenen Eitelkeit und begehen die Dummheit, sich vermarkten und stimmlich rui-nieren zu lassen. Deshalb gibt es auch keine Sänger mehr, die über eine lange Zeit auf gleich-bleibend hohem Niveau singen, von denen es in unserer Generation noch so viele gab. Es ist leider auch so, dass der heutige Opernbetrieb die Art von dramatischen Sängern, wie wir sie waren, die Nilsson, die Varnay, die Mödl und ich, nicht mehr benötigt. Was heute auf der Opernbühne geschieht, das ist doch zum großen Teil entstelltes und entseeltes Musiktheater.
Aber daran sind ja auch die Dirigenten und Intendanten schuld.
Ja, diese Entwicklung ist besorgniserregend. Vor allem das entstellte Spiel auf der Opernbühne ärgert mich so sehr. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch an eine Zukunft der Gattung Oper glauben kann, wenn ich mir die heutige Opernszene anschaue. Wenn sie so weitergeführt wird, wie sie gegenwärtig praktiziert wird, zweifle ich daran.
Was war für Sie das Ziel als Opernsängerin?
Das Ziel war, dass der Zuschauer in der Oper in eine Welt versetzt wird, die nichts mit dem Alltag zu tun hat. Dazu hat man sich schön angezogen und ist in einer festlichen Stimmung in die Oper gegangen. Oper Muss ein Glücksgefühl erzeugen, ein Angerührtsein von etwas, was man nicht auf der Straße findet, man muss schöne Stimmen, schöne Musik hören können in der Oper. Die „holde Kunst“ Muss uns auf der Opernbühne wirklich „in eine andere Welt“ versetzen können.
Aber weder Mozart, noch Wagner, Verdi oder Puccini wollten nur zum Plaisir des Publikums ein Fest auf der Bühne veranstalten! Sie hatten ja auch konkrete Anliegen und Intentionen, die mit Gesellschaftlichem, mit Politischem zu tun hatten! Oper will doch immer etwas mitteilen und hat eine konkrete Botschaft. Schon Wagner forderte, dass man mit Bildern von heute die Absichten von gestern auf die Opernbühne bringen solle, er war also sozusagen der Vater des modernen „Regietheaters“.
Aber es kann doch immer nur darum gehen, die Absicht des Komponierten, des Komponisten auszudrücken, meinetwegen mit neuen Bildern. Ich verurteile aber jede Entstellung des Komponierten, wie es heute so häufig im Regietheater anzutreffen ist. Ich bin nicht gegen eine Aktualisierung dessen, was ein Komponist hat sagen wollen. Aber die Oper Muss ihren ursprünglichen Gehalt, ihre ursprüngliche Absicht auf der Bühne behalten.
Frau Borkh, 1973 haben Sie Ihre Karriere in Palermo, im wunderbaren Teatro Massimo beendet. Sie hatten ein reiches künstlerisches Leben zu Ende gebracht. War der Wechsel ins Rentiers-Dasein schlimm für Sie?
Also es war nicht der Anfang eines Trauerspiels. Ich habe frühzeitig gewusst, dass ich nicht bis ins hohe Alter hinein singe. Das habe ich mir rechtzeitig gesagt. Ich habe mir zur rechten Zeit ein Leben aufgebaut, von dem ich mir vorstellte, dass ich es auch nach meiner Karriere würde weiterführen können. Deswegen bin ich in kein Loch hineingefallen, als ich meinen Abschied gegeben hatte. Was mir Probleme bereitete, war hingegen die Tatsache, dass mein Mann sich zu früh dem Alter überlassen, ja hingegeben hat. Damit hatte ich große Schwierigkeiten, denn dazu war ich noch zu lebensfreudig. Unser gemeinsames Leben deckte sich von da an nicht mehr. Im Gegensatz zu ihm habe ich noch viel herumgewirbelt nach Beendigung meiner Karriere, habe viele Aktivitäten entfaltet, habe Vorlesungen gehört, bin viel gereist, habe eine kleine zweite Karriere als Chansonsängerin gestartet. Das war eine Brücke ins Alter. Und jetzt lebe ich immer noch vital und lebenslustig, wie Sie sehen, obwohl ich alt bin, und nicht mehr arbeite.
Man kann über das Alter unterschiedlicher Meinung sein. Dass es Entbehrungen und Probleme mit sich bringt, steht außer Frage. Gibt es Ihrer Meinung nach auch etwas Positives, was man erst durch das Alter gewinnen kann?
Schon die Tatsache, dass wir so offen miteinander reden können, ist ein positiver Gewinn meines Alters. Während der Karriere können sie nicht so offen sein, da müssen sie Rücksicht nehmen, diplomatisch sein. Wenn man älter wird, gewinnt man Abstand zu den Dingen. Und die Wichtigkeiten verschieben sich! Das Wichtige rückt ins Zentrum. Was unwichtig ist oder war, verschwindet in Randbezirke. Vieles, was einen früher quälte, schmerzt nicht mehr.
10