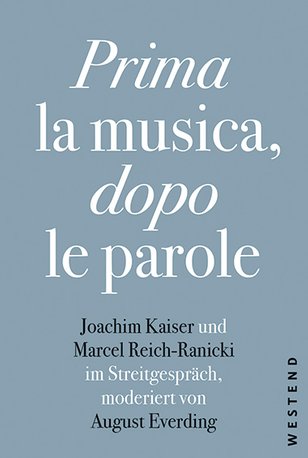Dieter David Scholz
Musik-Theater & mehr
Vergnügliches Dokument der Streitkultur. Dinosauriertreffen zur
Frage nach dem Vorrang von Musik oder Wort im Musiktheater
Im Jahre 1786 brachte der Wiener Hofkapellmeister Antonio Salieri das Divertimento teatrale „Prima la musica e poi le parole“ (Erst die Musik und dann die Worte) heraus, auf einem der Manuskripte findet sich auch die Titelvariante „Prima la musica, dopo le parole“ (was so ziemlich das gleiche bedeutet) . Das Stück ist eine Theatersatire, die Sitten und Unsitten der Oper aufs Korn nimmt und sich der Frage widmet, was wichtiger in der Oper ist, die Musik oder das Wort. Ein Thema, das die Opernkomponisten bis hin zu Richard Strauss immer wieder beschäftigte. Der hat es noch in seiner letzten Oper, die er komponiert hatte, in den Mittelpunkt gestellt, „Capriccio“, einem „Konversationsstück für Musik“, das 1942 urauf-geführt wurde. Unter dem als Frage gemeinten Titel „Prima la musica, dopo le parole“ fand bei den Richard-Strauss-Tagen 1995 eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde statt: Mode-riert von August Everding diskutierten Marcel Reich-Ranicki und Joachim Kaiser ihre Stand-punkte zu dem strittigen Verhältnis von Text und Musik in der Oper. Im Westendverlag wurde dieses Dinosauriertreffen der Großkritiker inzwischen als Buch veröffentlicht.
Die Frage nach dem Vorrang von Musik oder Wort im Musiktheater ist so alt wie die Gattung Oper. Immer wieder wurde sie gestellt. Bei Reich-Ranicki und Kaiser geht es eigentlich eher um die Frage: Was ist jedem von beiden wichtiger, Musik oder Wort? Das Gespräch beginnt mit Auseinandersetzungen über den Schriftsteller Ludwig Börne. Selbst er, eigentlich kein Profi in Sachen Musik, habe über Oper geschrieben.
„Das ist ja ein dankbares Thema, da kann jeder sagen, was er will" wirft Reich-Ranicki ein. Er weiß, wovon er spricht. Everding erinnert Ranicki daran, dass er ihm einmal anvertraut habe, er wäre am liebsten Dirigent geworden. Der kontert, das sei doch nichts als ein Traum gewe-sen. "Aber ich bin Dirigent vor allem aus einem Grunde nichtg geworden, weil mir die Musi-kalität und das Talent fehlen." Ein rares selbstkritisches Bekenntnis des ansonsten mit gesun-dem Selbstwertgefühl ausgestatteten Papstes der Literaturkritik. Ganz sicher gelte für die "allermeisten Opern auf dieser Erde: Erst das Wort und dann die Musik", postuliert Ranicki. Musik sei entstanden für ein bestimmtes literarisches Werk. Doch handelt es sich bei Libretti um Literatur? Ranicki holt zum großen Schlag aus: "Warum müssen wir verblödete Libretti ernst nehmen? Sachen, zu denen Komponisten wie Verdi komponiert haben, sind doch der letzte Schwachsinn." Das Wort Kitschstory fällt. Libretti könne man nicht ernst nehmen, "sie haben nichts mit Literatur zu tun." Verdi- und Puccini-Opern seien doch "ziemlich blöde".
Everding protestiert. Joachim Kaiser führt Wagners Parsifal ins Feld, da handele es sich doch um"ein Libretto von hohem literarischen Wert", und führt den Begriff der "Parola Scenica" ein. Libretti seien eben nur „halbe Texte“, die der Ergänzung durch Musik bedürften. Ranicki pflichtet versöhnlich bei: "Ein Libretto ist ein Halbfabrikat".
Dem Rosenkavalier bestätigt Ranicki immerhin eine gewisse Qualität. Er kenne den Text auswendig, aber es sei vor allem ein Vergnügen, den Rosenkavalier zu hören. Und doch gehe Vieles in der Musik des Hundert-Mann-Orchesters unter. Die Musik von Strauss dominiere doch den Text Hofmannsthals. Man streitet sich über die Rolle des Librettisten Hugo von Hofmannstahls und das finanzielle Kalkül des Komponisten Richard Strauss. Wer ist bedeu-tender, Strauss oder Hofmannsthal? Es geht hin und her. Ranicki wird es zu viel: "Alles sehr richtig, aber alles für die Kritiker." Dem breiten Publikum gehe es doch selten darum, Libret-tisten, Komponisten und Stücke zu verstehen und „richtig genießen“ zu wollen. Kaiser findet es grundfalsch, "dass man ausschließlich zum Vergnügen und zum Spaß hingeht." Oper sei nicht zum Amüsement da. Für die meisten Leute schon, entgegnet Ranicki. Das Publikum, so Ranicki, gehe doch beispielsweise nur in eine unbekannte Massenet-Oper, um eine spekta-kuläre Inszenierung zu sehen oder einen berühmten Sänger wie Placido Domingo zu hören. So sei das Publikum nun Mal.
Was ihn in einer Oper wie beispielsweise der des Rosenkavalier, den er so gut kenne, heute noch interessiere, sei nur die Inszenierung, und doch seien die meisten der 20 Inszenierungen, die er gesehen habe, "so idiotisch, dass ich das gar nicht sehen will." Und er prophezeit, dass auch der nächste Salzburger Rosenkavalier in Salzburg sicher wieder "irgendein Schwachsinn" werden würde. Daraufhin wirft August Everding Ranicki Demagogie vor. Es entflammt ein Streit über Regie und Regietheater. Everding fühlt sich in seiner Berufsehre gekränkt und zitiert Alfred Kerr: " Ein Kritiker sei frech gehässig." Nun fühlt sich Ranicki gekränkt und weist Everding in seine Schranken: "Der Oberbefehlshaber“ der Oper sei doch ohnehin der Dirigent.
Er gehe schließlich wegen der Musik ab und an „in eine anständige Tosca". Doch nicht wegen der Inszenierung? "Wenn sie in Erfurt ist, ist sie schwach, wenn sie in München ist, ist die Chance etwas besser." Ranicki setzt noch Einen drauf. „Wer singen kann, singt nicht in der Kleinstadt." Wer häufig in die Provinz geht, weiß, dass dort oft sängerisch erfreulichere, bessere Opern-aufführungen als in den Opernhauptstädten stattfinden. Das weiß auch August Everding und widerspricht. Ranicki rudert zurück und betont, dass man doch so gut befreundet sei, korrigiert seine Aussagen, wendet sie ins Versöhnliche.
August Everding, ein geborener Diplomat wirft ein: "Wahrhaft berufene Komponisten behandeln die Musik als eine ebenso präzise Sprache wie Wortsprache“, auch wenn sie "nie so präzise Inhalte mitteilen (könne) wie Worte." Ranicki widerspricht: "Natürlich kann die Musik das, das ist die große Möglichkeit der Musik".
Everding erinnert daran, dass man nicht über die höhere Wertschätzung von Musik oder Lite-ratur zu sprechen habe, sondern über die Bedeutung von Musik und Sprache bei der Erschaf-fung einer Oper. Es geht hin und her, man kommt auf Kurt Weill und Hanss Eisler, dann wie-der auf Wagner zu sprechen. Kaiser kritisiert Adorno uns statuiert: "Kunstwerke sind wahr, wenn sie besser sind als das, was der Autor nur bewusst da rein gepumpt hat.“ Ranicki pflich-tet bei und ergänzt: Kunstwerke veränderten sich durch die sich verändernde Welt und das sich verändernde Publikum. Schön und gut.
Man schweift ab ins Sprechtheater. Dann kommt Everding auf Wagners Tristan zu sprechen. "Tristan-Texte sind zum Teil schreckliche Sachen, und sprachlich furchtbar", so Ranicki. Kai-ser hält Wagners Bekenntnis dagegen: „ Meine Dramen sind ersichtlich gewordene Taten der Musik." Dann begeistert sich Ranicki enthusiastisch für die Meistersinger. Die "muss man aufführen. Ein Libretto von höchstem Rang." Aber er kann sich schon im nächsten Moment nicht verkneifen, zu betonen: "Kein einziges Bühnenwerk von Richard Wagner würde heute überhaupt erwähnenswert sein, wenn es nicht Musikwerke wären.“ Wagner und kein Ende. Wagner und nicht Strauss erweist sich als das eigentliche Zentrum der Altherren-Debatte bei den Richard Strauss Tagen.
Everding mahnt noch einmal das eigentliche Thema an: "Prima la musica, e poi le parole?" Kaiser gesteht: "Es ist sehr schwer zu beantworten." Die Herren schweifen wiedr ab in Entlegenes. Immer wieder ufern sie hochgebildet aus ins Schwadronieren, spreizen sich wie Hähne bei einem Hahnenkampf. Plötzlich stellt Everding fest "Mozart kam zu wenig vor". Doch da ist die Zeit schon fast um. Ranicki gesteht den Überdruss an Oper als Berufskrankheit der Kritiker. Keiner widerspricht. Dann ein Kompromiss aus seinem Munde. Es sei doch schön, dass die Oper "die allerbesten Komponisten gereizt hat, ihre Arbeitskraft, ihre Phan-tasie in eine menschliche Handlung zu investieren und es nicht bei einem Steichquartett oder bei der Sonate zu belassen."
Am Ende der denkwürdigen Talkshow dreier Koryphäen aus Musik, Literatur und Oper, die damals im Fernsehen ausgestrahlt wurde, bekennt August Everding „und alle Fragen bleiben offen“. Aber es lohnt trotzdem, den Abdruck der munteren, kampflustigen Gesprächsrunde zu lesen. Auch im Austausch der Eitelkeiten der drei kauzig-knorzigen „Alphatiere“ (Wie sie die Redakteurin von ZDF/3 sat, Martina Mattick-Stiller in ihrem kleinen Nachwort bezeichnet) ist die Lektüre noch ein geistreiches Vergnügen und ein Paradebeispiel von Streitkultur.
Artikel auch in Freie Presse