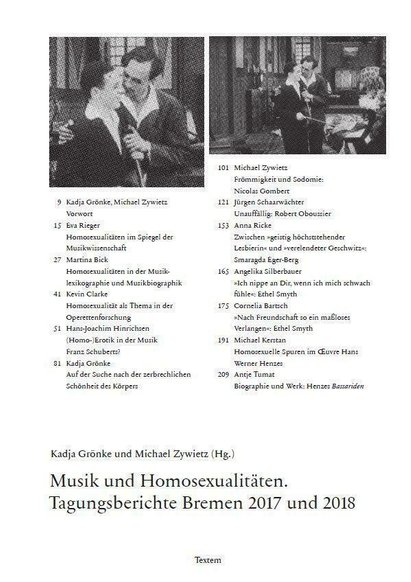Dieter David Scholz
Musik-Theater & mehr
Kadja Grönke und Michael Zywietz (Hg.):
Musik und Homosexualitäten.
Tagungsberichte Bremen 2017n und 2018
Textem Verlag, 457 S. ISBN 978-3-86485-259-6.
Musik und Homosexualitäten.
Heikles Thema, dröge Kost. Ein dicker Tagungsbericht
Im bereits 2010 erschienenen dicken Lexikon „Musik und Gender“ von Annette Kreutziger Herr und Melanie Unseld wird „Homosexualität“ als bereits 1869 geprägter Begriff definiert, der das „Innenleben homosexueller Männer und Frauen biologisch und psychisch zu erklären“ versuchte. 1990 hatten erstmals die Queer Studies den Begriff auf die Musikwissenschaft angewendet, um die „die Gleichgeschlechtlichkeit einzuschreiben in die Musikforschung“. 1994 kam in den USA das Buch „Queering the Pitch: The New Gay and Lesbian Musicology“ heraus, mit Essays zu schwul-lesbischen Perspektiven der Musikgeschichte. In Deutschland wurde dieser Impuls aus den USA weitgehend ignoriert. Bis Michael Zywietz 2007 ordentlicher Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule für Künste in Bremen wurde und damit Homosexualität zum Thema von Lehrveranstaltungen und Konferenzen machte.
Gemeinsam mit seiner Kollegin Kadja Grönke von der Universität Oldenburg hat er nun ein Buch vorgelegt, das die Arbeit fortsetzt, die sie mit dem 2018 erschienenen Buch »Musik und Homosexualität - Homosexualität und Musik« begonnen haben.
Der Tagungs-Band »Musik und Homosexualitäten« (gemeint mit diesem Plural sind wohl männliche und weibliche Homosexualität) vereint die Ergebnisse zweier Bremer Tagungen zu »Stand und Perspektiven musikwissenschaftlicher Homosexualitätenforschung« (2017) und »Homosexualitäten und Manierismen« (2018).
Die Herausgeber sind der Meinung, dass „Homosexualität nicht als Seitenzweig, der in queeren Forschungen stillschweigend mitgemeint ist, sondern als „Forschungsschwerpunkt eigenen Rechts“ Berechtigung hat, zumal „Begrifflichkeiten (noch) fehlen und Zweigeschlechtlichkeit die Gesellschaft prägt.“ Sie beklagen, dass „unser historisches Wissen über Sexualitäten in der Vergangenheit der Musikgeschichte“ gering ist und wollen „über Fachgrenzen hinaus“ einen sprudelnden Quell der Anregungen“ des Überdenkens traditioneller Positionen initiieren. Es geht um das „schwierige Ringen um eine wissenschaftliche, systematische und lexikalische Erfassung des Themas und um Korrekturen von „Vorurteilen und Klischees zum Thema Homosexualität“ inklusive einer „Genderisierung von Sprache“, was auch immer damit gemeint sein soll. (Beim Begriff „Gender“ stellen sich selbst eingefleischten Feministinnen zuweilen die Harre auf.)
Die „Mannigfaltigkeit der Untersuchungsansätze“ machen deutlich, wie heikel, disparat und vielschichtig das Thema ist. Ein erster Teil widmet sich der musikwissenschaftlichen „Homosexualitätenforschung“ also Methodenfragen und Fachgeschichte, der zweite Fallbeispielen und im dritten geht es um „Manierismus-Konzepte“, also jene „Schnittstelle von Künstlichkeit …und Homosexualität“.
Die Serie der 25 sehr unterschiedlichen Beiträge werden von Eva Rieger eröffnet, einer umstrittenen Autorin, die ihrer penetrant feministischen Positionen wegen zuweilen recht erfinderisch ist und mit Quellen und Fakten sehr frei umzugehen pflegt, wie von Ihren Kritikern immer wieder festgestellt wird. Sie ist denn auch der Meinung, „dass Mann- oder Frausein … in starkem Masse kulturell konstruiert ist“ und beklagt, was wahrlich keine neue Einsicht ist, die Defizite des Umgangs mit Homosexuellen. Die „Musikwissenschaft hat sich bis heute schwergetan mit dem Thema Homosexualität“. Wie wahr. Gleichgeschlechtliche Begehren müsse mit den „sozialen, kulturellen und theoretischen Aspekten des Themenkomplexes“ behandelt werden. Das versteht sich doch von selbst. Sie mahnt die „Entschlüsselung des Codes sexueller Subkulturen“ durch Überdenken traditioneller erkenntnistheoretischer Paradigmen an. Was sie damit konkret meint, verrät sie allerdings nicht.
Dass sie ausgerechnet den Textilfetischisten und Männerfreund Richard Wagner, der ein Paradebeispiel von ungefährdeten Womanizer war, zum Kronzeugen für Genderfragen abstempelt, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Wer Wagner genau kennt, weiß es besser! (Eine differenzierte Arbeit über „Richard Wagner und die Homosexualität“, seinen erstaunlich fortschritt-lichen Umgang mit ihr trotz eigener Heterosexualität, an der nicht zu zweifeln ist, erscheint demnächst auf dem Büchermarkt.)
Eine umfassende Beschäftigung mit dem Thema Homosexualität und Musik stehe in Deutschland noch aus. Aber das wissen wir doch nun schon seit Jahren. Und dann kommt Eva Rieger auf ihre immer wieder suadahaft vorgetragene Lieblingsthese zu sprechen: Wir leben „immer noch in einer Gesellschaft, die Frauen im Vergleich zu Männern politisch, symbolisch und ökonomisch benachteiligt und damit hegemoniale Strukturen aufrechterhält.“ Sie wettert einmal mehr gegen die „herrschenden Geschlechter-Arrangements in Westeuropa“ und fordert eine Sensibilisierung für „die Forschung zu lesbischen Strukturen. „Doing gender ist auch ihr Losungswort, sie spricht über Queer-Theorie, erwähnt Michel Foucault und manche schwulen Komponist: innen, wettert gegen Vorurteile und das „Verwischen von Geschlechtergrenzen“, ja plädiert dafür, „dass mehr Menschen, die sich bisher ausgegrenzt fühlen, von einer Musikkultur profitieren können, die anstelle des bisherigen Lächerlichmachens und der Ausgrenzung von gleichgeschlechtlich Liebenden von einer selbstverständlichen Zugehörigkeit aller Minderheiten in der Gesellschaft ausgehen.“ Gut gemeinte Worte sind das, aber doch Platitüden.
Wesentlich konkreter wird Martina Bick in ihrem Beitrag über Homosexualitäten in der Musiklexikographie und Musikbiographik mit ihren genauen Untersuchungen zu Franz Schubert, Peter Tschaikowski, Benjamin Britten, Hans Werner Henze und Aribert Reimann, aber auch Ethel Smythe, Wanda Landowska und Lina Ramann, um nur einige zu nennen, deren Homosexualität in den gängigen Nachschlagwerken bis in jüngste Vergangenheit oft verschleiert oder gar tabuisiert werden. Es geht ihr um heikle „persönliche und intime biografische Informationen“, die geeignet sind, „Hierarchisierungen, Diskriminierungen, Ausschlüsse und sogar Verfolgung von Individuen vorzunehmen.“
Kevin Clarke plädiert in seinem Vortrag – und das ist sein Dauerthema – für „Homosexualität als Thema in der Operettenforschung,“ beklagt das existierende Defizit in der Forschung und macht sich wie immer stark für homosexuelle Operettenkomponisten und -Librettisten, ja für die gewagte – nicht unumstrittene – These, dass Homosexualität ein zentrales Thema des Genres sei.
Dass Franz Schubert, seine Sexualität und seine Musik geradezu ein „lehrreiches wissenschaftsgeschichtliches Fallbeispiel“ darstellen, erläutert Hans-Joachim Hinrichsen lang und breit mit besonders detaillierten (mit vielen Notenbeispielen aufwartenden) Ausführungen zum Lied, zu biographischen Verrückungen, fragwürdigen Schubert-Bildern und Schubert-Debatten.
Mit Hans Werner Henze und Aribert Reimann beschäftigt sich Kadja Grünke, die – den französischen „Philosophen, Theoretiker, Essayisten und Homosexuellen Roland Barthes“ mitbedenkend, auf „der Suche nach der zerbrechlichen Schönheit des Körpers“. Ihr Fazit. „bei allen Menschen, die bereit sind, eine gewisse Rauheit des Klanges als körperhaft zu rezipieren, kann Musik von Reimann, von Henze, aber eben auch von Ligeti eine sehr eigene Form der Ästhetik begründen.“ Ob diese in Verbindung „mit Eros oder gar mit Homosexualität gebracht wird, steht auf einem anderen Blatt,“ so die Autorin und sie zitiert aus Fontanes „Effi Briest“, dies zu untersuchen sei „ein weites Feld“. Ja was denn nun?
Einen besonders pikanten Fall von Homosexualität im europäischen Spätmittelalter, ein Fall von „Frömmigkeit und Sodomie“ rollt Michael Zywietz auf am Beispiel des Kapellmeisters am Hofe Karls V., Nicolas Gombert. Ein Exkurs zur drakonischen Gleichsetzung und Bestrafung von Sodomie (männlicher Homosexualität), Ehebruch, Blutschande und Bigamie, unter Berufung aufs Alte Testament (Genesis 19,5). Der Beitrag darf als ein gutes Beispiel historischer Genderforschung betrachtet werden.
Jürgen Schaarwächter wendet sich einem weithin vergessenen, ja totgeschwiegenen Schweizer Homosexuellen zu, dem Komponisten Robert Oboussier, seinem Leben und Schaffen in bemühter Unauffälligkeit. Immerhin erfährt man in dem wortreichen Text: „Die Homosexualität hat in den 1940er- und 50er Jahren geblüht in Zürich.“ Wie interessant!
Der „Wahrnehmung der homosexuellen Musikerin Smaragda Eger-Berg“ widmet sich Anna Ricke. Ihr Beitrag ist überschrieben „Zwischen „geistig höchst stehende Lesbierin“ und „verelendeter Geschwitz“. Eine Studie über die „homophilen Kreise in Berlin und Wien,“ über „Erinnern und Vergessen, Gedächtnis und Gender“ mit dem Ziel, einen neuen „Blick auf diese Fragen nach weiblicher musikkultureller Teilhabe, nach homophilen Netzwerken in Wien und nach den diskursiven Zusammenhängen zischen Homosexualität und Künstlerinnenschaft“ zu werfen.
Natürlich darf auch die schon zu ihrer Zeit als Lesbe (sie selbst bezeichnete ihre sexuelle Identität als „sapphism“, so erfährt man) berühmte Ethel Smyth (Brahms nannte sie verächtlich die Schmeißfliege) nicht fehlen in diesem Zusammenhang. Angelika Silberbauer untersucht „strategische Entsexualisierung homoerotischer Narrative,“ der Komponistin, die sich „gegen die Stereotype und das geläufige Weiblichkeitsideal ihrer Zeit“ gestellt habe. Den Opern der Ethel Smyth geht Cornelia Bartsch auf den homoerotischen Grund.
„Homosexuelle Spuren im Oeuvre Hans-Werner Henzes“ ist das Thema Michael Kerstas. Seine These: auch in diesem Falle sei „die Forschung hin- und hergerissen zwischen Legitimierung und Pathologisierung“. Soso. Dabei hat doch Henze aus seiner Homosexualität kein Geheimnis gemacht, wie der Autor weiß und wer die Opern Henzes kennt, weiß Bescheid. Übrigens habe die Musik Bachs Henze und seinen Lebensgefährten Fausto Moroni (der angeblich auch gut kochen konnte) verbunden, so erfährt man. Am Beispiel von Henzes Bassariden untersucht Antje Tumar den Zusammenhang von „Biographie und Werk“. Klaus Oehl widmet seine Ausführungen Henzes Klarinettenkonzert nach Genets „Le Miracle de la Rose“ als „homosexuelles Schlüsselwerk. Für schwule Henzefans dürfte dieser Band ein Fest sein.
Leonard Bernstein, der wohl renommierteste amerikanische Komponist, der immer wieder das Thema Homosexualität verarbeitete und sich auch selbst geoutet hat, darf natürlich auch nicht vergessen werden: „I have this pain“ ist der Beitrag von Markus Schneider überschieben: „Beschädigte Identität in Leonard Bernsteins Oper A quiet Place“ ist sein Thema.
Noch weiter geht Jürgen Scharwächter. Er sprich von „Selbstinszenierung und exotistischen Prototypen“ am Beispiel des Komponisten (britischer Herkunft und parsischer Abstammung) Kaikhosru Srabji, den nur wenige Leser kennen dürften.
„Über das Künstlerpaar Benjamin Britten und Peter Pears“ schreibt Juana Zimmermann und referiert doch nur altbekannte Fakten, Tatsachen und Zusammenhänge zwischen erotischer Beziehung und Werk, wie sie zahlreichen Abhandlungen und Büchern, nicht zuletzt den hervorragenden Publikationen von Norbert Abels bekannt sind.
Wolfram Boder kommt dem Spohr-Schüler Hugo Staehle auf die Schlichte und glaubt, in dessen erster Sinfonie das „Manifest einer homoerotischen Beziehung“ zu erkennen, das dem Kasseler Dichter Jakob Hoffmeister gewidmet war. Die Freundschaft von Clement Harris und Siegfried Wager steht im Fokus eines Aufsatzes von Katharina Hottmann. Bernd Feuchtner schreibt anlässlich der Fehde des Frankfurter Säulenheiligen Th. W. Adornos mit Golo Mann brilliant und aufschlussreich über die Frage: „War Adorno homophob?“. Golo Mann wird bescheinigt, er habe „ein verlorenes Leben gelebt.“ Grund sei die oft zu beobachtende „psychologische Fesselung“ der Produktivität „geistig begabter Homosexueller“ so Feuchtner. Das Fazit seiner 34-seitigen Ausführungen: „Die Homosexualität … spielt in Adornos Texten nur eine kleine Nebenrolle.“ Wieso dann diese langstieseligen Ausführungen, fragt sich wohl mancher Leser.
Der „ambivalenten Musik des Begehrens“ widmet sich Ulrich Wilker am Beispiel von Ravels ‚L´heur espagnole‘. In ihre erkennt er “Heterosexualität als ‚comédie musicale‘. Ein Beispiel dafür, „wie manieristisch das Konzept Homosexualität“ sei.
(Anmerkung am Rande, In einem Interview in der taz meinte Michael Zywietz: „Als Merkmal der homosexuellen Musik wird vermutet, dass die Manieriertheit, also die Übersteigerung der Komposition, auf die Homosexualität der Komponist: innen hindeutet.“)
Dem pflichtet Kevin Clark auch in seinem zweiten Beitrag bei, in dem er anhand der Musicals den Manierismus als Maske der Homosexualität zu erkennen glaubt. Manierismus in Ken Russels Musikerfilmen geht Kadja Gröne nach, Dieter Ingenday widmet sich Manierismus (und Neo-Barock) in der lateinamerikanischen Literatur. Axel Duncker beleuchtet Arno Schmidts manieristische Schreibweise als Umgang mit Homosexualität in seinen Erzählungen. Und Gregor Schuhen rückt im Schlusskapitel schließlich dem „Dandy zwischen Hegemonieanspruch und Homosexualitätsverdacht“ zu Leib, insbesondere dem schwulen Dandy „als marginalisierte Figur „degenerierter Männlichkeit“. Ein Beispiel, „wie Kunst und Männlichkeit spätestens seit dem ausgehenden 19 Jahrhundert unter ständiger Beobachtung stehen“, der Oscar Wilde-Prozess und die Eulenburg-Affäre seien beste Beispiele dafür.
Ein weites Feld also, das der 457-seitige Band beackert. Dröge Kost. Reichlich eitle, oftmals reichlich gespreizte akademische Schreibe und zur Schau gestellte Gelehrtheit herrschen vor. Sehr interessant, gewiss. Aber nicht alles, was da geschrieben wird, ist unbedingt wichtig und lesenswert. Leicht zu lesen ist das Buch jedenfalls nicht. Keine Bettlektüre für Jedermann bzw. jede Frau. Nur eingefleischte, um nicht zu sagen besessene Interessierte des besagten Zusammenhangs dürfte die geduldige Lektüre des Bandes wirklich Gewinn und Erkenntniszuwachs bescheren.
Beitrag auch in Operalounge